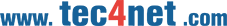Wer heimlich einen Mieter im Treppenhaus vor seiner Wohnungstür mit einer versteckten Kamera überwacht, um herauszufinden ob dieser seine Wohnung unerlaubt untervermietet, hat vor Gericht wenig Erfolg: Laut BGH dürfen die dabei gemachten Aufnahmen nicht als Beweismittel verwendet werden.
Mieter dürfen ihre Wohnung gem. § 540 BGB nur mit Erlaubnis des Vermieters untervermieten. Wer ohne eine Erlaubnis untervermietet, kann gekündigt werden, sofern der Vermieter dies nachweisen kann. Eine mögliche Beweisführung könnte die Überwachung des Treppenhauses mit verdeckten Videokameras sein, so dachte im Jahr 2017 eine landeseigene Berliner Wohnungsgesellschaft.
Was war geschehen
Mehrere Mieterinnen standen zu dieser Zeit unter dem Verdacht, ihre angemieteten Vier- oder Fünfzimmerwohnungen ohne Erlaubnis unterzuvermieten und wurden deshalb abgemahnt. Da diese Maßnahme jedoch keine Veränderung der Situation bewirkte, beschloss die Wohnungsgesellschaft nun handfeste Beweise zu sammeln. Sie beauftragte eine Privatdetektivin, die die Wohnungseingangstüren mithilfe versteckter Kameras überwachen sollte.
In den vier Wochen der Videoüberwachung öffneten regelmäßig Personen, die nicht die Mieterinnen waren, mit einem eigenen Schlüssel die Türen und betraten die Wohnungen. Dabei waren Gesichter, Kleidung und der jeweilige Wohnungseingang klar erkennbar. Die Wohnungsgesellschaft sah ihren Verdacht damit als belegbar an und kündigte sowohl außerordentlich als auch hilfsweise ordentlich und forderte die Mieterinnen zur Räumung der Wohnungen auf.
Die Mieterinnen verweigerten die Räumung der Wohnungen und protestierten gegen die heimlichen Videoaufnahmen. Eine der Parteien beschuldigte die Vermieterin, Methoden der Stasi anzuwenden, und forderte eine Entschädigung für die Verletzung ihres Persönlichkeitsrechts. In Reaktion darauf erhob die Vermieterin eine Räumungsklage, der das Amtsgericht Berlin-Mitte stattgab. Eine zusätzliche Entschädigungsforderung wurde hierbei jedoch abgewiesen. Im Nachgang kippte das Landgericht Berlin dieses Urteil hinsichtlich der Räumung, und der Bundesgerichtshof (BGH) hat nun mit Urteil vom 12.03.2024 – VI ZR 1370/20 folgendes entschieden:
Die Verwertung der Videoaufnahmen ist unzulässig.
Nach Ansicht der Karlsruher Richter hat die Wohnungsgesellschaft keinen Anspruch auf Räumung der Wohnungen, da die ausgesprochenen Kündigungen das Mietverhältnis nicht rechtsgültig beendet haben. Der wesentliche Grund für die Kündigung war die vorgeblich unerlaubte Weitervermietung der Wohnungen. Dies kann jedoch nicht berücksichtigt werden, da sich die Klägerin ausschließlich auf die erstellten Videoaufnahmen zur Beweisführung stützte, die von einem Gericht nicht als Beweismittel zugelassen werden dürfen.
Begründung der Entscheidung
Die Verwendung der Aufnahmen im Rahmen der freien Beweiswürdigung nach § 286 ZPO widerspricht nach Ansicht des BGH dem Datenschutz. Die heimliche Erhebung personenbezogener Daten ist gemäß § 4 Abs. 1 BDSG a.F. unzulässig, da die Aufnahmen in einem Bereich vorgenommen wurden, der in den Schutzbereich der Privatsphäre der Mieter fällt.
Eine Abwägung der Interessen fällt laut den Richtern eindeutig zugunsten der gefilmten Personen aus. Ihre Rechte auf Achtung des Privatlebens (Art. 7 GRCh) und auf Schutz personenbezogener Daten (Art. 8 GRCh) seien erheblich verletzt worden. Auch das Treppenhaus eines Wohnhauses gilt nicht als öffentlich zugänglich, sodass niemand erwarten muss, dort gefilmt zu werden. Der Vermieterin standen durchaus weniger eingreifende Mittel zur Verfügung, um die Weitervermietung zu belegen, wie etwa die Befragung von Nachbarn oder die Durchführung von Scheinanmietungen.
Das Gericht wies ebenfalls die Verwertung der verarbeiteten personenbezogenen Daten gemäß Art. 4 Nr. 2 DSGVO zurück, da diese nicht im öffentlichen Interesse lagen. Zwar sei der Staat verpflichtet, seinen Bürgern eine effektive Rechtspflege zu ermöglichen, die eine gründliche Würdigung des vorgelegten Beweismaterials erfordere. Dennoch habe die Wohnungsgesellschaft mit den Aufnahmen nur ein Indiz geliefert, da das vierwöchige Geschehen vor einer Wohnungstür noch nicht als Beweis für eine Untervermietung angesehen werden könne, solange der Aufenthaltszweck der gefilmten Personen unklar bleibt. Auch die Kündigung aufgrund des Vergleichs mit der Stasi konnte den Vertrag nicht auflösen. Diese Äußerung sei als Meinungsäußerung durch das Grundrecht der Meinungsfreiheit geschützt und wurde daher gemäß § 193 StGB als Ausübung rechtmäßiger Interessen betrachtet.
Ausgang des Verfahren
Die oben erwähnte Entschädigung für die Verletzung der Privatsphäre in Form von Geld wurde der Mieterin vom Gericht letztlich nicht zugesprochen. Der BGH hielt die Genugtuung durch das Urteil zugunsten der Mieterin, das auch die Rechtswidrigkeit der Maßnahmen feststellt, für ausreichend.
Matthias A. Walter, http://www.tec4net.com
EDV-Sachverständiger und Datenschutzauditor
Quellen und Links:
Entscheidung des Bundesgerichtshofs (BGH)
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=3cea7e1cffadb9de7c1125a8e836a318&nr=138020&anz=1&pos=0
Charta der Grundrechte der Europäischen Union
https://dejure.org/gesetze/GRCh
tec4net – Datenschutz und IT-Sicherheit praktikabel umsetzen
Wir beraten und auditieren DSGVO und BDSG sowie die Normen ISO/IEC 27001, TISAX und PCI-DSS.
www.tec4net.com – www.it-news-blog.com – www.it-sachverstand.info – www.datenschutz-muenchen.com